Wellness am Meer
Das Adria-Relax-Resort Miramar setzt die lange Geschichte Opatijas als Heilkurort fort. Moderner Komfort und neue Services machen das Resort noch attraktiver. ...
Das Adria-Relax-Resort Miramar setzt die lange Geschichte Opatijas als Heilkurort fort. Moderner Komfort und neue Services machen das Resort noch attraktiver. ...
Wolfgang Böck ist Schauspieler, Fernsehstar und Intendant. Im Interview mit schauvorbei.at gibt er Einblicke in sein Tun, seine Berufung und sein einmaliges Leben, das nicht ohne ein paar gekonnte Eingriffe von Fortuna entstanden wäre. In einer ...
Anna Fuhrmann ist jung, ehrgeizig und Weltmeisterin im Jiu Jitsu: 2023 holte die 25-Jährige in der Mongolei die Goldmedaille im Fighting bis 48 kg. Ihr Weg zum Erfolg war jedoch alles andere als leicht. Im Gespräch ...
Ob fürs Picknick, einen Grillabend oder die Gartenparty: Ein Linsensalat mit hausgemachtem Fladenbrot passt im Frühling und Sommer eigentlich immer. Dabei ist das Gericht schnell zubereitet und strotzt nur so vor Vitaminen und Ballaststoffen. In der ...



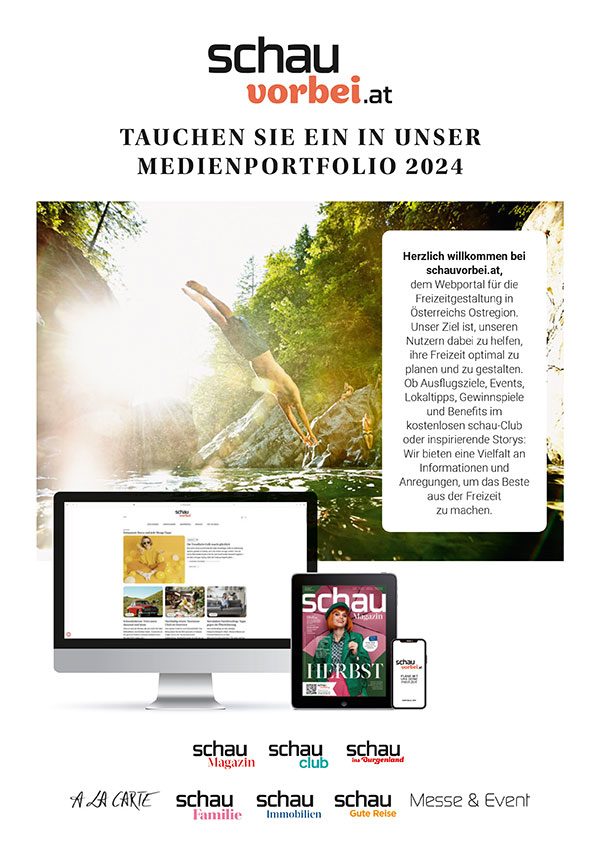
Im Planetarium Wien ist der Sternenhimmel zum Greifen nahe: Modernste Technik projiziert mehr als 9.000 Sterne und Himmelskörper so realistisch wie sonst nirgendwo auf die Kuppeldecke. In zahlreichen Shows und Vorträgen erfahren große und kleine Astro-Fans Wissenswertes über unseren Kosmos. ...
Mit über eintausend Jahren Geschichte gilt Krems an der Donau als die älteste Stadt in ...
Barocke und historische Architektur prägen das Jagdschloss in Eckartsau, das bei einer Führung besichtigt werden ...
Das Wiener Parlament steht Besuchern jederzeit für Entdeckungsreisen zur Verfügung. Gäste tauchen im interaktiven Demokratikum ...
Das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, ist ein ganz besonderer Ort. Große ...
Im nostalgischen Dorfmuseum Mönchhof unweit des Neusiedler Sees unternehmen die Besucher eine Zeitreise. Dabei erleben ...
Seit der ersten Erwähnung 1236 erlebte die Burg Bernstein im Burgenland eine äußerst wechselhafte Geschichte. ...
Die Hofgassen von Mörbisch sind ein Ausflugsziel für Romantiker: In den alten Gässchen scheint die ...
Das Landesmuseum Burgenland in Eisenstadt eröffnet Einblicke in 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte der Region. In der ...
Eine Stadt, die seit 1963 unter Denkmalschutz steht und dennoch äußerst lebendig ist: Das gibt ...