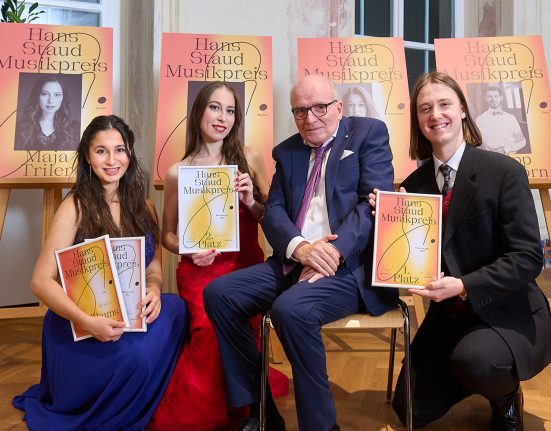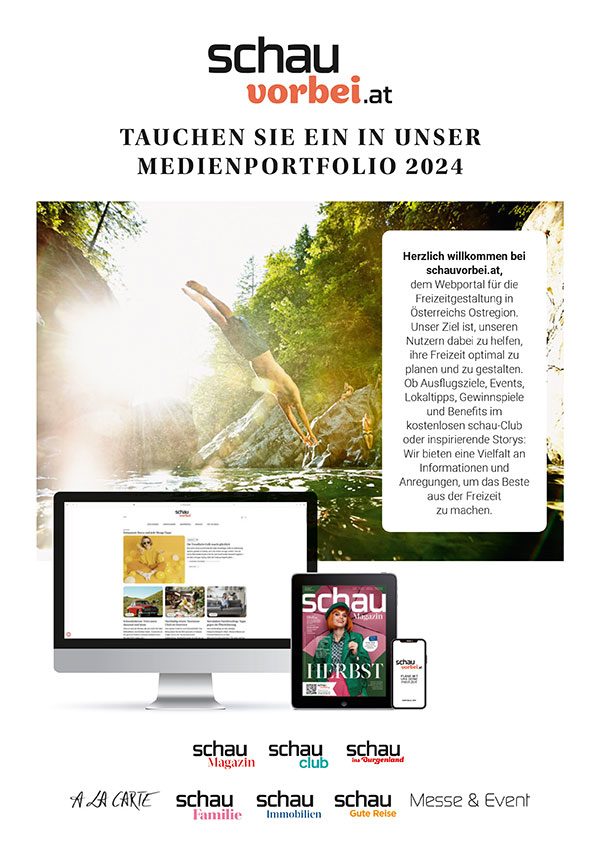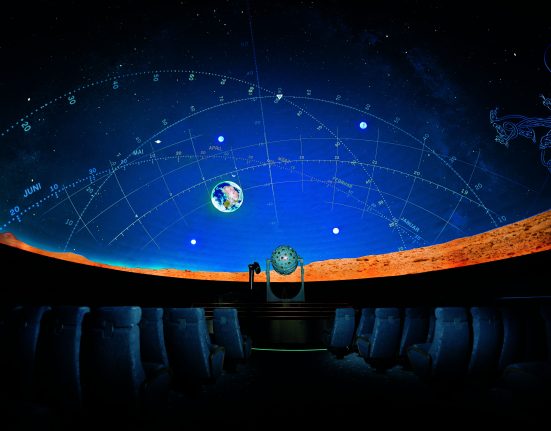Job-Trend FOBO: 5 Tipps gegen die „Fear of being offline“
Im Homeoffice ständig online sein, aus Angst, etwas Wichtiges zu verpassen – selbst während einer kurzen Fünf-Minuten-Pause? Wem dieses Gefühl bekannt vorkommt, der leidet wahrscheinlich unter FOBO. Was man gegen die „Fear of being offline“ tun kann, verrät ...