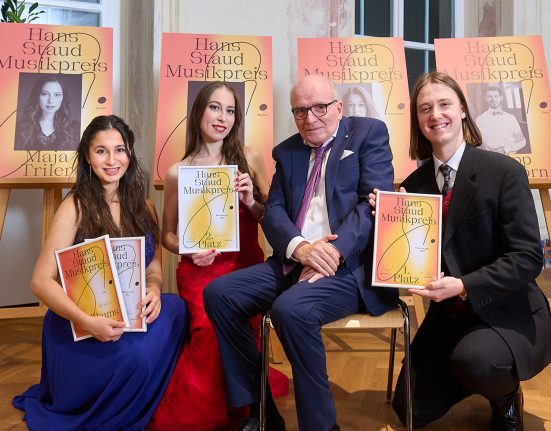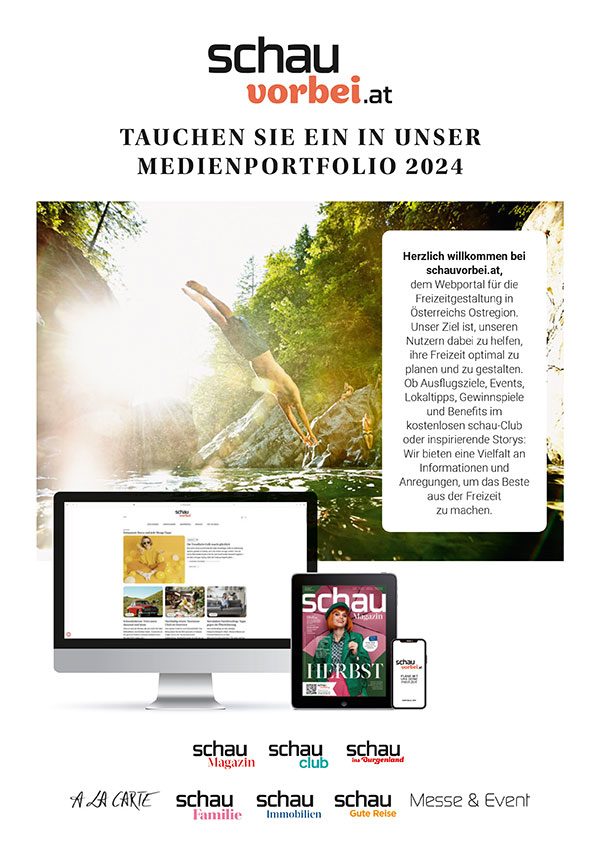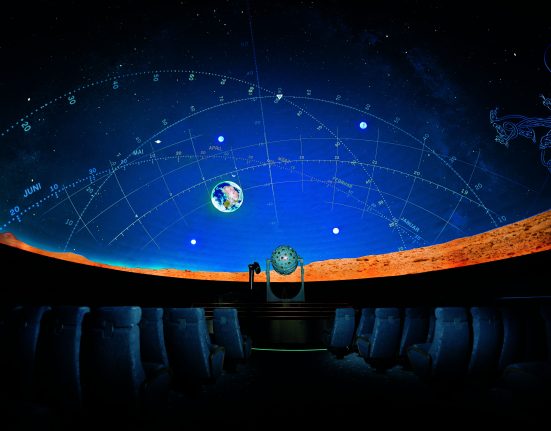Anna Fuhrmann: Die Jiu-Jitsu-Weltmeisterin im Zoom-Talk
Anna Fuhrmann ist jung, ehrgeizig und Weltmeisterin im Jiu Jitsu: 2023 holte die 25-Jährige in der Mongolei die Goldmedaille im Fighting bis 48 kg. Ihr Weg zum Erfolg war jedoch alles andere als leicht. ...